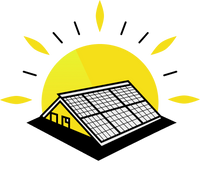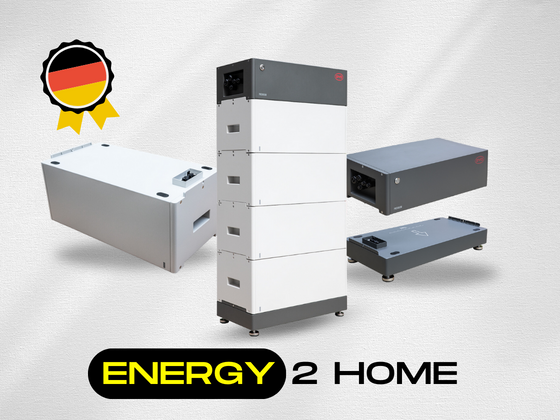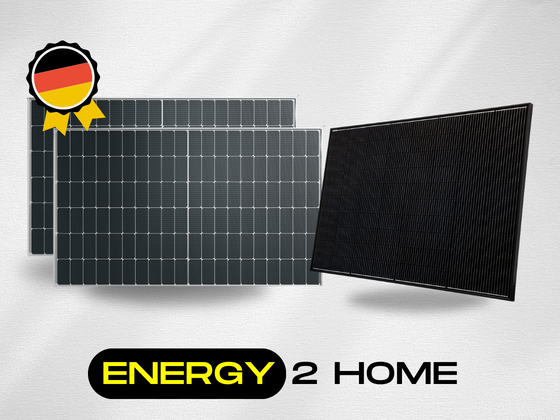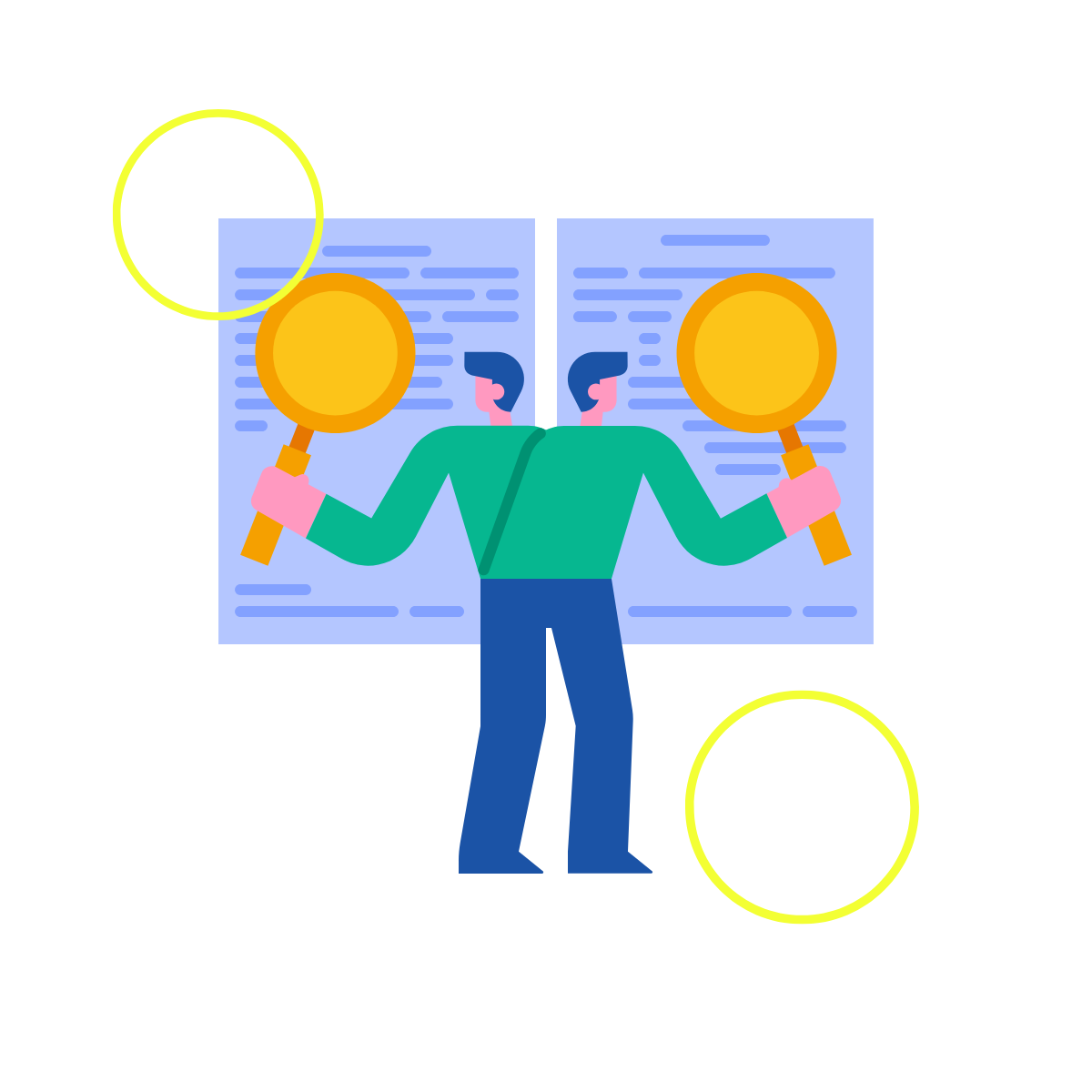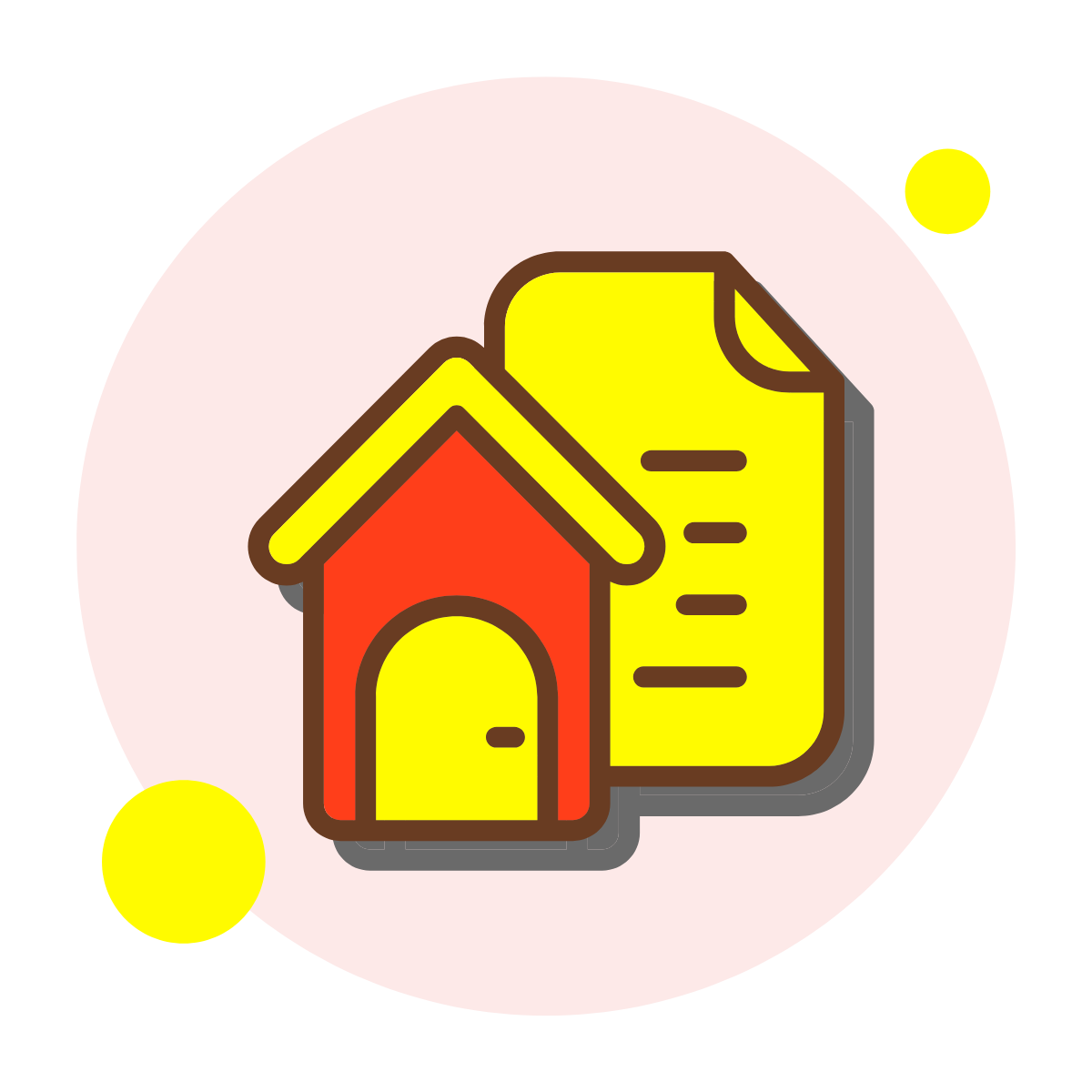Photovoltaik-Speicher: Wirtschaftlichkeit und die Rolle der Einspeisevergütung
Einleitung
Die Installation einer Photovoltaik-Anlage (PV-Anlage) auf dem eigenen Dach ist für viele Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer zu einem attraktiven Investitionsprojekt geworden. Doch während die Solarstromerzeugung tagsüber ihren Höhepunkt erreicht, findet der Großteil des Stromverbrauchs oft in den Morgen- und Abendstunden statt, wenn die Sonne nicht scheint. Hier kommen Solarstromspeicher ins Spiel, auch als Batteriespeicher oder Heimspeicher bekannt. Sie speichern den tagsüber erzeugten Überschussstrom, um ihn dann zu nutzen, wenn er tatsächlich benötigt wird. Die zentrale Frage, die sich dabei stellt, ist: Rechnet sich ein solcher Speicher wirtschaftlich und inwiefern beeinflusst die Einspeisevergütung diese Entscheidung?
Funktionsweise und Kosten von Solarspeichern
Ein Photovoltaik-Speicher ist im Grunde eine große Batterie, die in das Hausstromnetz integriert wird. Der von den Solarmodulen erzeugte Gleichstrom (DC) wird entweder direkt vom Wechselrichter in Wechselstrom (AC) umgewandelt und verbraucht, oder der Überschuss wird über einen Batteriewechselrichter oder Hybrid-Wechselrichter in den Speicher geleitet und dort als chemische Energie gespeichert. Bei Bedarf wird der gespeicherte Strom wieder in Wechselstrom umgewandelt und für den Eigenverbrauch bereitgestellt.
Die Anschaffungskosten für einen Batteriespeicher sind in den letzten Jahren kontinuierlich gesunken. Dennoch sind sie eine nicht unerhebliche Investition. Der Preis pro Kilowattstunde (kWh) Speicherkapazität variiert je nach Hersteller, Technologie und Größe. Aktuell liegen die Kosten pro Kilowattstunde Speicherkapazität im Bereich von 300 bis 600 Euro, wobei die Gesamtkosten für eine Anlage mit Speicher schnell 10.000 Euro und mehr betragen können. Es ist wichtig, auch die Installationskosten und die voraussichtliche Lebensdauer des Speichers in die Wirtschaftlichkeitsberechnung miteinzubeziehen.
Die Einspeisevergütung und die Amortisation
Die Einspeisevergütung ist ein vom Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) festgelegter Betrag, den Anlagenbetreiber für jede Kilowattstunde Solarstrom erhalten, die sie in das öffentliche Stromnetz einspeisen. Die Höhe dieser Vergütungssätze hängt von der Anlagengröße und dem Zeitpunkt der Inbetriebnahme ab und wird für 20 Jahre garantiert.
Mit Stand August 2025 beträgt die Einspeisevergütung für Kleinanlagen bis 10 kWp bei Teileinspeisung (mit Eigenverbrauch) 7,86 Cent/kWh. Im Gegensatz dazu liegen die Strombezugskosten aus dem Netz deutlich höher. Eine zentrale Annahme für die Rentabilität eines Speichers ist der steigende Strompreis. Jede selbst verbrauchte Kilowattstunde spart die teuren Bezugskosten aus dem Netz, während die eingespeiste Kilowattstunde nur mit einem geringeren Satz vergütet wird.
Dies führt zu einem klaren wirtschaftlichen Anreiz: Es ist finanziell deutlich vorteilhafter, den selbst erzeugten Strom zu verbrauchen, als ihn gegen die vergleichsweise niedrige Einspeisevergütung ins Netz einzuspeisen. Ein Batteriespeicher erhöht den Eigenverbrauch massiv, von typischerweise 30-40% ohne Speicher auf bis zu 70-80% mit Speicher. Dies steigert die Autarkie des Haushalts erheblich und mindert die Abhängigkeit von externen Stromversorgern.
Wirtschaftlichkeitsanalyse: Wann rechnet sich ein Solarspeicher?
Die Amortisation eines Batteriespeichers ist eng mit mehreren Faktoren verknüpft:
-
Stromverbrauch und Strompreis: Je höher der jährliche Stromverbrauch und je höher der Strompreis, desto schneller amortisiert sich der Speicher. Ein hoher Grundverbrauch in den Abendstunden ist ideal für die Ausnutzung des Speichers.
-
Anlagenleistung: Die Größe des Speichers sollte zur Größe der PV-Anlage und zum Verbrauchsprofil des Haushalts passen. Ein zu großer Speicher wird möglicherweise nie vollständig geladen, ein zu kleiner Speicher kann den Bedarf nicht decken.
-
Kosten und Lebensdauer des Speichers: Die sinkenden Anschaffungskosten machen Speicher zunehmend rentabel. Eine lange Garantiezeit von 15 Jahren und mehr sowie eine hohe Zyklenfestigkeit (Anzahl der Lade- und Entladezyklen) sind entscheidende Kriterien für eine nachhaltige Investition.
Studien und Faustregeln zeigen, dass ein Solarstromspeicher heute durchaus wirtschaftlich sein kann, wenn die Kosten pro kWh Speicherkapazität unter 600-650 Euro liegen. In vielen Fällen amortisiert sich ein Speicher nach 10 bis 14 Jahren, während die Lebensdauer der Geräte oft 15 bis 20 Jahre beträgt.
Fazit
Die Entscheidung für oder gegen einen Solarspeicher hängt maßgeblich von der individuellen Situation ab. Angesichts der vergleichsweise niedrigen Einspeisevergütung und der stetig steigenden Strompreise ist der finanzielle Anreiz für die Maximierung des Eigenverbrauchs größer denn je. Ein Batteriespeicher ermöglicht es, die Unabhängigkeit vom Stromnetz deutlich zu steigern und langfristig von den sinkenden Gestehungskosten des eigenen Solarstroms zu profitieren. Kurz gesagt: Der Speichereinsatz rechnet sich heute nicht mehr nur ökologisch, sondern auch zunehmend ökonomisch und wird zu einem essenziellen Bestandteil einer zukunftsfähigen und nachhaltigen Energieversorgung.