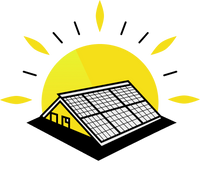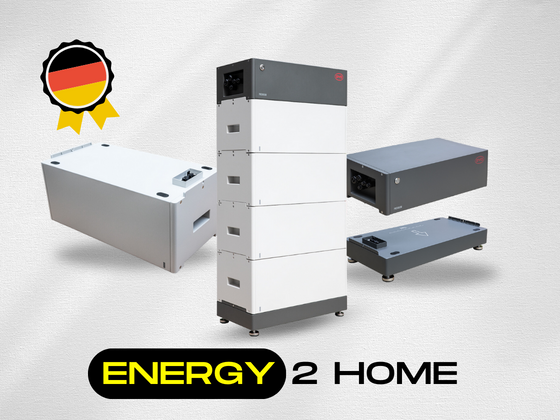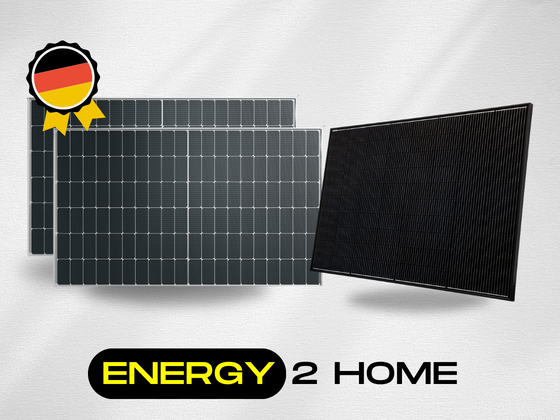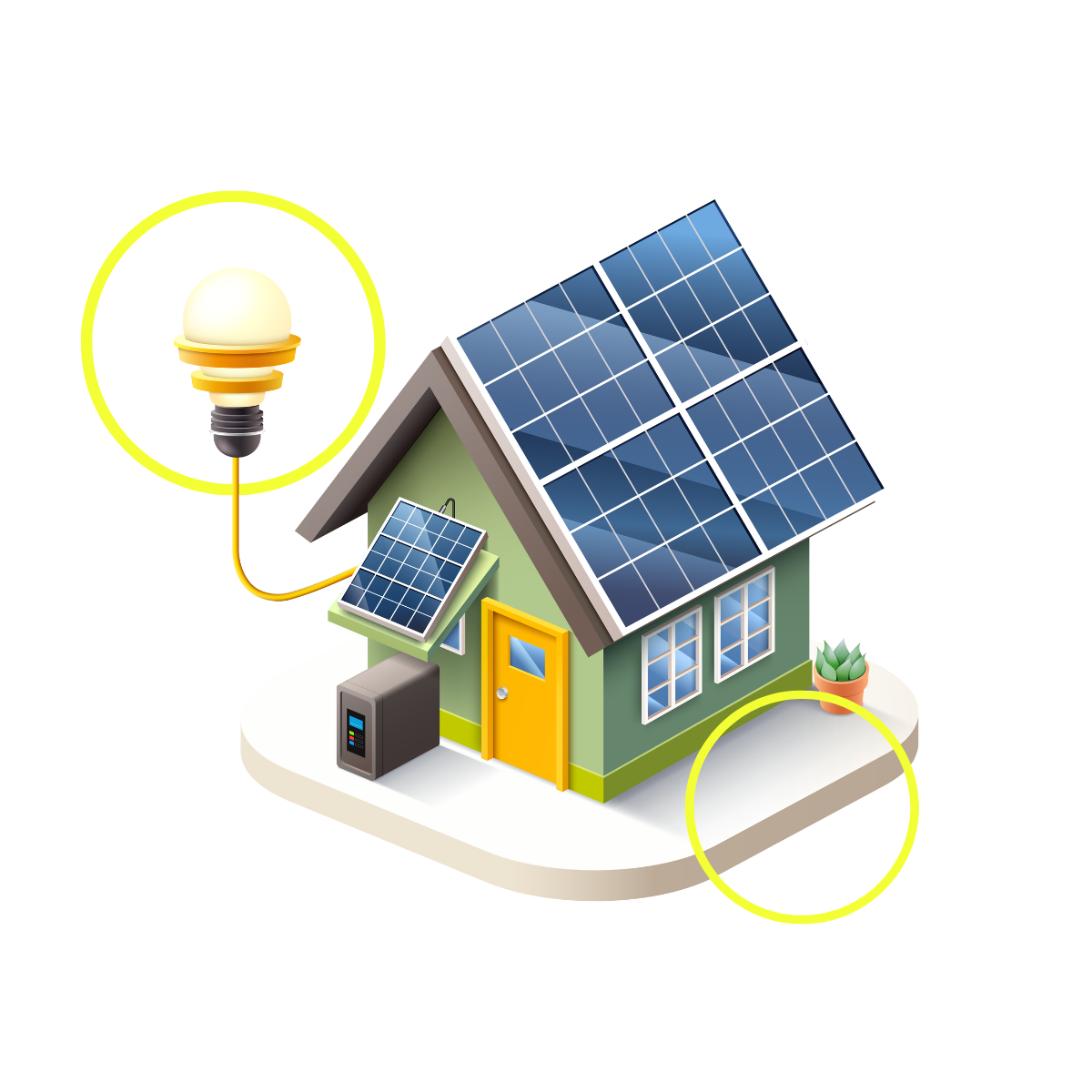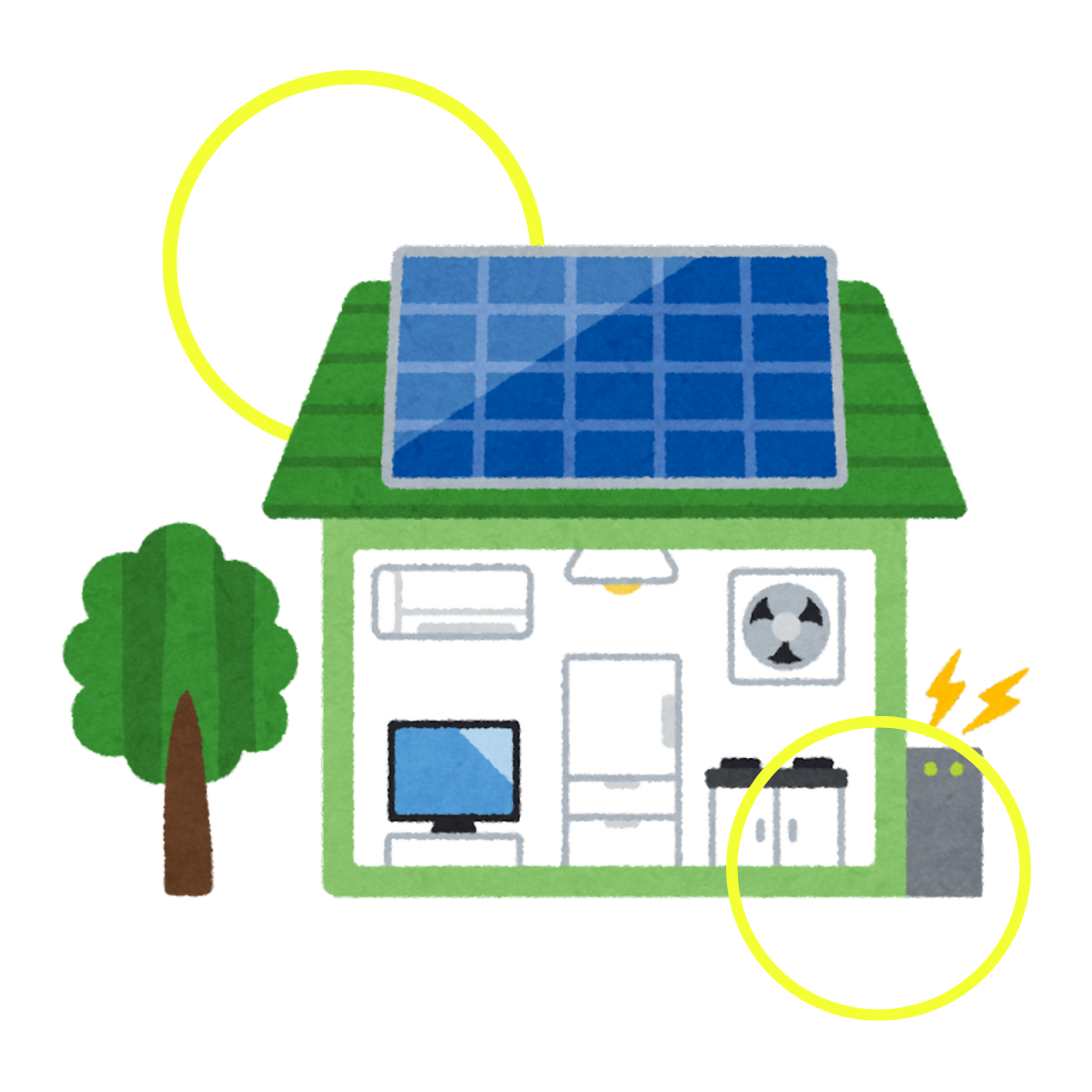Das eigene Kraftwerk für den Balkon: Ein Leitfaden für Balkonkraftwerke
Einleitung
Der Wunsch nach Unabhängigkeit von konventionellen Energieversorgern und die steigende Sensibilität für nachhaltige Energiegewinnung haben in den letzten Jahren zu einem signifikanten Anstieg der Popularität von Photovoltaik-Anlagen geführt. Eine besonders attraktive und zugängliche Option sind sogenannte Balkonkraftwerke oder auch Mini-PV-Anlagen. Diese kompakten, steckerfertigen Solarsysteme ermöglichen es Mieterinnen und Mieter sowie Eigentümerinnen und Eigentümer von Wohnungen, eigenen Strom zu erzeugen. Doch bevor man sich für ein solches System entscheidet, gilt es, die rechtlichen und technischen Rahmenbedingungen zu verstehen.
Was ist ein Balkonkraftwerk?
Ein Balkonkraftwerk ist eine dezentrale, netzgekoppelte Photovoltaik-Anlage, deren installierte Leistung typischerweise unter 800 Watt (in Deutschland) liegt. Sie besteht in der Regel aus einem oder zwei Solarmodulen, einem Mikro-Wechselrichter und den notwendigen Anschlusskabeln. Der erzeugte Gleichstrom wird vom Mikro-Wechselrichter in netzkonformen Wechselstrom umgewandelt und über einen herkömmlichen Schuko-Stecker direkt in die häusliche Elektroinstallation eingespeist. Der so erzeugte Strom wird unmittelbar für den Eigenverbrauch genutzt und reduziert die Stromrechnung.
Rechtliche Rahmenbedingungen und Genehmigungen
Obwohl Balkonkraftwerke als "steckerfertige" Systeme beworben werden, sind bestimmte Genehmigungen und Anmeldepflichten unerlässlich, um einen sicheren und gesetzeskonformen Betrieb zu gewährleisten.
-
Anmeldung beim Netzbetreiber: Die wichtigste Hürde ist die Anmeldung beim örtlichen Verteilnetzbetreiber (VNB). Jede Anlage, die Strom ins öffentliche Netz einspeist – und sei es nur theoretisch im Überschuss – muss dem VNB gemeldet werden. Die Anmeldung erfolgt in der Regel über ein vereinfachtes Verfahren. Der Netzbetreiber prüft unter anderem, ob der vorhandene Stromzähler für die Einspeisung geeignet ist. Ältere Ferraris-Zähler können rückwärtslaufen, was technisch illegal ist. In diesem Fall muss ein Zwei-Richtungs-Zähler oder ein Smart Meter installiert werden. Die Kosten für den Zählerwechsel übernimmt in der Regel der VNB.
-
Eintragung ins Marktstammdatenregister (MaStR): Gemäß dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) müssen alle PV-Anlagen, unabhängig von ihrer Größe, im Marktstammdatenregister (MaStR) der Bundesnetzagentur registriert werden. Dies dient der statistischen Erfassung und der Gewährleistung der Netzsicherheit. Die Registrierung ist kostenfrei und obligatorisch.
-
Meldung an den Vermieter oder die Eigentümergemeinschaft: Für Mieterinnen und Mieter ist die Zustimmung des Vermieters in der Regel eine zwingende Voraussetzung. Obwohl es Gerichtsurteile gibt, die eine generelle Untersagung als nicht zulässig ansehen, ist die Absprache unerlässlich, um Konflikte zu vermeiden und sicherzustellen, dass die Installation den baulichen Anforderungen genügt. Bei Eigentumswohnungen muss die Installation von der Eigentümergemeinschaft genehmigt werden. Hierfür ist oft ein Beschluss in der Eigentümerversammlung erforderlich.
-
Technische Voraussetzungen und Sicherheitsbestimmungen:
-
Stecker: Es wird empfohlen, einen Energiestecker (auch als Wieland-Stecker bekannt) anstelle eines herkömmlichen Schuko-Steckers zu verwenden. Der Wieland-Stecker verhindert ein unbeabsichtigtes Ziehen unter Last und bietet besseren Berührungsschutz. Einige Netzbetreiber fordern die Verwendung dieses Steckers explizit.
-
Elektroinstallation: Die Installation muss über eine separate Stromleitung oder einen festen Stromkreis verfügen, um eine Überlastung der Leitung zu vermeiden. Ein Überlastungsschutz durch einen Leitungsschutzschalter (Sicherung) ist obligatorisch.
-
Wechselrichter: Der Mikro-Wechselrichter muss den VDE-Normen (insbesondere VDE-AR-N 4105) entsprechen und über eine Inselnetzerkennung (ENS) verfügen, die bei Netzausfall die Einspeisung sofort unterbricht. Dies schützt Wartungsarbeiter vor Stromschlägen.
-
Montage: Die Befestigung der Solarmodule muss fachgerecht und sicher erfolgen, um Sturmschäden oder eine Gefährdung Dritter auszuschließen.
-
Fazit
Balkonkraftwerke sind eine hervorragende Möglichkeit, aktiv zur Energiewende beizutragen und gleichzeitig die eigenen Stromkosten zu senken. Die Einfachheit der Installation ist jedoch nicht gleichbedeutend mit einer Genehmigungsfreiheit. Eine sorgfältige Planung, die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften und die Kommunikation mit dem Netzbetreiber, dem Vermieter und der Eigentümergemeinschaft sind unerlässlich. Nur so lässt sich das Potenzial der dezentralen Stromerzeugung sicher und effizient nutzen.